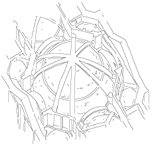Das Schloss in Mötzing-Schönach im Landkreis Regensburg zeigte erhebliche Schäden und Mängel. Im Mai 1995 waren Teile der Decke des Festsaals abgestürzt. Im Rahmen der statisch-konstruktiven Voruntersuchung von 2015/2016 waren weitere Schäden an den übrigen Stuckdecken, dem Dachwerk, den Gewölben und der Aussteifung der Wände festgestellt und Maßnahmen zur Notsicherung eingeleitet worden. Die Instandsetzung des Schlossbaus war dringend notwendig.
Ziel der Instandsetzungsarbeiten von 2021 bis 2024 waren einerseits die statisch-konstruktive Sicherung des Gebäudes, sowie andererseits Maßnahmen zur Konservierung der Deckenfresken und die Fertigstellung der Stuck- und Putzarbeiten.
Ein Schloss wird in Schönach erstmals im 12. Jahrhundert erwähnt. Nach einer in der Eingangshalle angebrachten Inschriftentafel wurde das Schloss in den Jahren 1557-59 durch die Familie von Seiboldsdorf neu erbaut. Wesentliche Teile dieses Renaissancebauwerks dürften sich in der heutigen Anlage erhalten haben. Unter der Familie von Königsfeld erfolgte ab 1702 eine umfassende Umgestaltung zu dem heutigen barocken Erscheinungsbild. Der Entwurf hierzu wird Giovanni Antonio Viscardi zugeschrieben, Bauleiter war der Landshuter Maurermeister Wolf Ehamb. Für die Ausgestaltung waren der Stuckateur Giovanni Niccolò Perti und der Freskenmaler Hans Georg Asam verantwortlich, der mit seiner ganzen Familie in Schönach arbeitete. An einer der Fresken im Festsaal war bis zum Teileinsturz die Jahreszahl 1704 in der Sense des Kronos vorhanden (Saturn-Darstellung). Nach Übernahme der Hofmark durch Graf von Seinsheim 1763 wurden neben der Umgestaltung der Fassaden mit neuen Fenstern auch größere Reparaturen der Decke über dem Festsaal durchgeführt sowie die Kabinette in der Nord-Ost Ecke des ersten und zweiten Obergschosses eingebaut.
Seit 1983 ist das Schloss im Besitz der Familie von Einsiedel.
Das Schloss ist weitgehend im barocken Orginalzustand erhalten.
Das Hauptgebäude befindet sich zwischen dem an der Nordseite angelegten Ökonomiehof und dem nach Süden ausgerichteten Schlosspark. Der dreigeschossige Walmdachbau vom Typus eines Stadtpalastes bedeckt eine Grundfläche von ca. 20 m Breite und 32 m Länge. Die Fassaden sind mit einem rustizierten Sockelgeschoss und einer Pilastergliederung in den Obergeschossen gestaltet. Deutlich zeichnet sich an der Westseite der über die gesamte 8-achsige Gebäudebreite und beide Obergeschosse reichende Festsaal ab.
Im Erdgeschoss befinden sich vermutlich noch ältere Gewölberäume, wohingegen die beiden Obergeschosse mit nahezu deckungsgleichen Grundrissen beim Umbau ab 1702 mit großen Salons und dem zweigeschossigen Festsaal ausgestattet wurden.
Das Walmdach über dem Hauptgebäude ist als dreigeschossiges Kehlbalkendach mit stehenden Stühlen in den beiden unteren Dachgeschossen ausgebildet und erreicht bei ca. 13,5 m Traufhöhe und einer Dachneigung von ca. 40° eine Firsthöhe von ca. 22 m. Die Walmflächen sind mit ca. 60° deutlich steiler geneigt. Alle Dachflächen sind mit Biberschwanzziegeln in Doppeldeckung eingedeckt.
Die Gespärre lagern auf Mauerlatten auf den Außenwänden sowie auf den massiven Flurwänden auf. Die Zerrbalkenlage ist in Gebäudequerrichtung ausgerichtet, unter den Walmen sind Stichbalken an einen diagonalen Balken unter dem Grat geführt. Alle Zerrbalkenköpfe waren in die Gesimse eingemauert. An jedem zweiten Sparren befand sich eine Gesimsrückankerung. Die Sparren sind an die Zerrbalken mit Zapfenverbindungen angeschlossen. Vermutlich aufgrund frühzeitig eingetretener Schäden wurden 1781/82 unter den Sparren angenagelte Knaggen und eine umlaufende Fünfkantschwelle eingefügt.
Die Hölzer der Dachkonstruktion waren durch Nässe und nachfolgendem Pilzbefall umfangreich geschädigt. Auflager waren abgesackt und viele Verbindungen hatten sich geöffnet. Die nachträglich eingebauten historischen Sprengwerke waren nicht mehr tragfähig.
Bei allen Deckenputzen, besonders im 2. OG, waren folgende Schäden sichtbar: Ablösung der Putzlatten von den Deckenbalken bzw. Zerrbalken, Schädigung der Putze zwischen den Putzlatten durch eindringende Feuchtigkeit und nachfolgender Zerstörung der Stroharmierung durch Pilze, fehlende bzw. zerstörte Bockshaut, Ablösung der Deckenputze bzw. Stuckierungen von den Putzlatten, Risse, Verwerfungen im Putz durch ungleichförmige Deformation des Dachtragwerks. Teile der Hohlkehle waren durchgebrochen und abgestürzt.
Hinweise auf Schäden an der Stuckdecke im Festsaal finden sich bereits in Akten aus dem Jahr 1925. Beim Aufmaß 2015 wurde ein Durchhang der Decke von ca. 15 cm von den Wänden zur Raummitte festgestellt. Der Teil-Absturz im Jahr 1995 konnte unter anderem auf Mängel in der ursprünglichen Konstruktion zurückgeführt werden. Teilweise war die Konterlattung zusammen mit der Putzlattung mit geschmiedeten Nägeln an den Balken befestigt worden. Schon eine kleine Bewegung konnte bei der dort geringen Einbindetiefe zu einer Lockerung führen. Durch die konische Form der Nägel war ein Halt der schweren Decke so nicht mehr möglich.
Die Instandsetzung der Dachkonstruktion verlief in mehreren Abschnitten, für die das Wetterschutzdach jeweils umgesetzt wurde.
Ausgeführt wurden folgende Arbeiten:
– querschnittsgleiche Reparaturen der Sparren, Stuhlsäulen, Schwellen und der Mauerlatte
– Verankerung der Sparrenfußpunkte zu den Zerrbalken
– Überarbeitung aller geöffneten Verbindungen
– Rückverformung von stark verformten Gespärren
– Einbau einer lastverteilenden Dielung bzw. Deckenscheibe auf die Zerrbalken über dem Festsaal
– Reparatur der geschädigten Auflager der mittleren Sprengwerke
Zusätzlich erfolgte der Einbau von quer verlaufenden Überzügen aus Brettschichtholz über dem Festsaal. Die Stuck- und Putzdecke über dem Festsaal wurde mittels Gewindestangen und Federpaketen aus Tellerfedern an die Überzüge angehängt. Die Federpakete wurden hydraulisch auf moderate Kräfte angespannt. Bei diesem Anspannvorgang wurden sowohl die Kräfte als auch die Verformungen kontrolliert. Mit Hilfe der Federpakete können gewisse Setzungen und hygrisches Schwinden der Konstruktionshölzer kompensiert werden. Der Federweg der Tellerfedern kann jederzeit nachgemessen werden und wird regelmäßig kontrolliert. Bei Bedarf könnte nachgespannt werden.
Bei allen Reparaturen in der Zerrbalkenlage wurde darauf geachtet, Verformungen möglichst zu reduzieren, um weitere Schäden an den Stuckdecken zu vermeiden. Aus diesem Grund wurden die Zerrbalken und die gebrochenen Kehlbalken der Bindergespärre mit Beilaschungen repariert. Dennoch war eine geringfügige Rückverformung der Zerrbalkenlage unvermeidbar. Darum wurden die Zimmererarbeiten in enger Zusammenarbeit mit dem Stuckateur ausgeführt und notwendige Sicherungen der Stuckdecke umgehend eingebaut.
Die Biberschwanzdeckung einschließlich Dachlattung sowie die Dachentwässerung und der Blitzschutz wurden vollständig erneuert und Einflugöffnungen für Fledermäuse in Kupferblech neu ausgebildet. Die Kaminköpfe wurden teilerneuert und neu verputzt. Die Mauerkrone wurde gesichert und in Teilen neu aufgemauert. Die Gesimse wurden vom Stuckateur neu gezogen.
Parallel dazu erfolgten die Vorsicherung der Decken und Befunduntersuchungen sowie Arbeitsmuster durch den Stuckateur und den Restaurator Raumschale. Hierbei wurden auch die abgestürzten Stuck- und Freksenteile im Festsaal gesichtet, sortiert und die Wiederverwendbarkeit, sowie die Möglichkeiten, sie ihrem ursprünglichen Ort im Fresko zuzuordnen, untersucht.
Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt hatten zur Sicherung und Festigung der Putze und Malereien gedient, sowie zur schrittweisen Erprobung der Arbeitsweisen für die weiteren Arbeiten an Decken und Raumschale. Die Arbeiten zur Restaurierung von Putz und Stuck im zweiten Bauabschnitt schlossen sich nahtlos an: Die durch eindringende Feuchtigkeit und nachfolgenden Befall durch den Echten Hausschwamm zerstörten Putze wurden rückgebaut, markante und noch nicht geschädigte Teile der Stuckierung wurden abgenommen, wenn ein Verbleib nicht möglich war, da zunächst die Unterkonstruktion repariert werden musste. Wo eine Gefährdung der Stuckierung durch Salze ausgeschlossen werden konnte, wurden diese Teile wiederversetzt.
Abhängig von der jeweiligen Situation vor Ort wurden zur Sicherung und Reparatur der Putze und Stuckierungen unterschiedliche Methoden angewendet: mechanische Sicherung der Putze bzw. Stuckierungen von unten, mittels Verschraubung mit den Zerrbalken bzw. neu eingebauten Wechseln bzw. mechanische Sicherung der Putzlatten von oben. Die chemisch-mineralische Verbindung der bestehenden Grundputze mit der neuen Bockshaut wurde durch Festigung der vorhandenen Putzoberfläche erreicht, die Halterung der Stuckierung wurde mit Hanf- oder Sisalschnüren verstärkt. Gesimse und Stuckrahmen wurden zwischen den wiederversetzten Originalteilen neu gezogen.
Während der Sicherung und Konservierung der Deckenfresken wurde in jedem Raum gesondert entschieden, welche Arbeiten zur Substanzsicherung durchgeführt würden. Freilegungen und Gemälderestaurierungen waren nicht vorgesehen. Freilegungsproben oder Reinigung wurden nur dort durchgeführt, wo dies nach den Festigungsarbeiten später nicht mehr möglich gewesen wäre. Kittungen erfolgten zum Teil mit eingefärbtem Mörtel.
Die Putze mancher Fresken zeigen Verwerfungen infolge der umfangreichen Zerstörungen und der Reparaturen der Deckenkonstruktion. Um die Niveauunterschiede in Rissnähe zu reduzieren wurden die Hohlräume zwischen Lattung und Grundputz gesäubert und die Putze vorsichtig angedrückt, dieser Zustand dann mit Kalkmörtel stabilisiert. Das oben beschriebene Vorgehen wurde ausschließlich im Gemäldebereich durchgeführt und in jedem neuen Fall einzeln neu entschieden, Verwerfungen in Stuckprofilen bzw. Rücklagen blieben immer bestehen und wurden lediglich leicht angeböscht.
Im Bereich der Fehlstellen der Gemälde im Festsaal wurde der Grundputz aufgetragen, beim Hauptgemälde mit stärker zurückgesetzter Oberfläche, damit die abgestürzten Freskoteile ggf. zu einem späteren Zeitpunkt wieder applizert werden könnten.
Alle nicht wiedereingebauten Stuck- und Fresken-Teile werden in einem Lapidarium im Dachraum sicher verwahrt.
Zusätzlich zu den vom Zimmerer eingebauten Spannankern wurden die Gebäudeecken noch durch in den Wänden längs laufende Maueranker versteift. Der Boden einzelner Räumen über dem EG wurde mittels Stahlträger abgefangen. Die Gewölbe über dem EG wurden mittels Abmauerungen in der Deckenebene stabilisiert. Nach Rückbau des Innengerüsts wurden die Natursteinplatten des Bodens im Festsaal repariert und teilweise neu verfugt. Parallel zur Instandsetzung des Gebäudes wurden zusätzliche Heizkörper eingebaut und die Elektroinstallation größtenteils erneuert.
Alle Arbeiten wurden in enger Zusammenarbeit mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und mit dem Landesamt für Denkmalpflege bei regelmäßigen Ortsterminen abgestimmt.
Trotz der Erschwernisse durch die besonderen Vorgaben im Rahmen der Corona-Epidemie konnten die Arbeiten vor Ort wie geplant durchgeführt und im Juli 2024 abgeschlossen werden.
Die klimatischen Bedingungen in den stuckierten Räumen werden noch in den folgenden Jahren überwacht, der Zustand von Gebäude und Dach soll regelmäßig überprüft werden.
Alle Dokumentationen wurden digital erstellt, in einem Online-Speicher gesammelt und stehen nach Abschluss der Maßnahme auf Datenträgern zur Verfügung.
Das Ziel der Maßnahme, die Fertigstellung aller Putz- und Stuckarbeiten und die Konservierung der Fresken und Gemälde nach der statisch-konstruktiven Instandsetzung von Schloss Schönach, wurde vollumfänglich erreicht. Nun droht keine Gefahr weiterer Schäden in absehbarer Zeit. Zukünftige weitere Restaurierungsarbeiten im Gebäude sind nun ohne zeitlichen Druck durch eine Gefährdung der Substanz möglich.
Es bleibt der Rohzustand der Raumschale, ohne Restaurierung bzw. Retuschen bestehen, allerdings teilweise mit farbiger Einstimmung der Reparaturen. So haben die Räume ihre eigene neue Ästhetik gewonnen. Sie sind „fertig“, da erlebbar und nutzbar.
Beteiligte:
- Bauherr: privat
- Denkmalschutz: Landesamt für Denkmalpflege Herr Dr. Seehausen, Frau Tschoepe
- Dokumentation: Landesamt für Denkmalpflege Herr Dr. Linck, Herr Forstner
- Untere Denkmalschutzbehörde: Landratsamt Regensburg, Herr Dr. Feuerer
Das Büro Bergmann führte folgende Leistungen aus:
- Aufmaß
- Statisch-konstruktive Untersuchung
- Objektplanung
- Tragwerksplanung
- Bauüberwachung